
|
OBEROTTERBACH

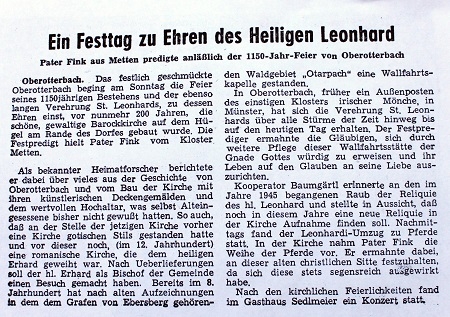
Oberotterbach begeht 1955 die 1150-Jahrfeier
Der Name Otterbach taucht zum ersten Male in zwei Urkunden aus der Zeit von 870-875 auf. Es handelt sich an diesen
Stellen sicherlich um Oberotterbach. Aber wir können nicht die Frage entscheiden, ob der lateinische Ausdruck ad
Otarpach eine Siedlung zu Otterbach oder die Gegend am Otterbach meint. Es ist ein großes Waldgebiet, das von
Otterbach über die heutige Straße nach Landshut hinweg bis Oberhatzkofen reichte. Dieses Gebiet besaß um 870 der
Kanzler des Grafen Ratold von Ebersberg, namens Alawichus, der Priester war und dem Adel angehörte. Die Grafen
von Ebersberg besaßen im Großen Laabertale ausgedehnte Besitzungen, die sich von Pfeffenhausen bis Sandsbach
erstreckten. Der Name Ratold kehrt im 10. Jhd. in der gräflichen Familie wieder. Ein Graf Ratold von Ebersberg,
vielleicht ein Enkel des Ratold von 870, war 950 Statthalter in Kärnten. Alawichus hatte seine Ausbildung in der
königlichen Kanzlei zu Regensburg erhalten. Er trat in Beziehung zu König Ludwig dem Deutschen, der seit 837 sein
Hoflager in Regensburg hatte. Ludwig war es auch, der Alawichus das Gebiet überließ. Der gräfliche Kanzler hatte
auch in Hatzkofen Besitzungen. Alawichus überließ im Tauschwege das weite Gebiet Bischof Ambricho von Regensburg
und erhielt dafür die Kirche in Holzhausen mit Grund und Boden, der zu ihr gehörte. Der Ort bei Pfeffenhausen
besitzt heute keine Kirche, vielleicht war sie ursprünglich vorhanden, ist aber dann später verfallen.
Es erhebt sich nun die Frage, was der Bischof mit dem Gebiet angefangen hat. Es wurde von einer alten Straße
durchschnitten, die ihren Ausgangspunkt in Regensburg hatte und nach Mauern bei Moosburg lief, wo sie in eine
Straße von und nach Augsburg einmündete. Die Straße lässt sich heute noch an verschiedenen Stellen nachweisen.
An der Straße hatte ein Rumolt einen Hof gebaut, das heutige Ramelsdorf. Es drängt sich die Vermutung auf, dass
der Bischof damals die Pfarrei Oberhatzkofen organisierte, der er das ganze Waldgebiet zuwies. Es ist doch
auffallend, dass die Einöden Seidersbuch und Wiedenberg erst im letzten Jahrhundert in die Rottenburger Pfarrei
eingemeindet wurden. Die Namen der beiden Einöden belegen den waldigen Charakter der Gegend. Sie musste erst der
Siedlung erschlossen werden. Der Wald wurde durch Feuer geschwendet; daher der Name der Einöde Brandhof, die
immer zur Pfarrei Oberhatzkofen gehörte.
Es drängt sich eine zweite Frage auf, nämlich: Wie kam König Ludwig der Deutsche in den Besitz des ausgedehnten
Waldgebietes? Er war doch kein Bayer, sondern fränkischen Geblütes. Die Antwort ist ganz einfach. Große Waldungen
verblieben in den Händen der Agilolfinger Tassilo. Karl der Große, der fränkische König, stürzte ihn in diesem
Jahre und verwies ihn in ein Kloster. Er nahm für sich, was bisher in herzoglichem Besitz war. So kam unser
Waldgebiet in Karls Hände. Von ihm erbte es sein Enkel Ludwig der Deutsche, der es an Alawichus abtrat. Trifft
diese Annahme zu, so ergeben sich wieder zwei neue Fragen. Die eine von ihnen lautet: Warum gehörte Otterbach,
die Kirche und die Siedlung, nie zur Pfarrei Oberhatzkofen? Das Waldgebiet reicht heute noch im sogenannten
Frauenwalde an die Grenze des Marktes. Die zweite Frage lautet: Wie kommt es, dass in der Galgenlohe Felder liegen
oder lagen, die vom Pfarrhof in Rottenburg aus bewirtschaftet wurden? Kirchlicher Besitz erhält sich vielfach ohne
Veränderung. Wir kommen nun der Sache um ein beträchtliches Stück näher. Otterbach gehörte immer zur Pfarrei
Rottenburg, die am Anfang ihren Mittelpunkt im Dorfe Münster hatte.
Der Name des früheren Pfarrsitzes, Münster, 1080, Munstiure, besagt, dass hier in der Frühzeit ein Kloster
bestand. Es geht auf die Zeit zurück, wo irische Mönche, die sich im Lande der Franken niedergelassen, bei den
Bayern erschienen, um sie für den wahren Glauben zu gewinnen. Die Mönche wohnten nicht gemeinsam, sondern einzeln
oder zu zweien oder dreien in Zellen oder Klausen. Sie hatten aber als Mittelpunkt eine Kirche, bei der sie am
Samstag und Sonntag den Gottesdienst gemeinsam feierten. Diese Kirche war gewöhnlich dem Apostelfürsten Petrus
geweiht. Wegen dieses Patroziniums erweist sich heute noch die Kirche in Münster als Wohnung des Abtes, des
Hauptes der Mönchsgenossenschaft. Bei ihm weilte nur der Nachwuchs, den er persönlich ausbildete. Die irischen
Mönche wählten für ihre Niederlassungen gerne Plätze, wo Straßen vorbeiführten. Auch Münster liegt an einer
alten Straße, deren Verlauf bereits geschildert wurde. Die Mönche hatten so Gelegenheit, die Gastfreundschaft
auszuüben. Sie wollten in Verbindung mit der Bevölkerung kommen und ihr das Christentum nahebringen. Eine Klause,
in der irische Mönche wohnten, nehme ich in Otterbach an. Der Platz war gut gewählt. Die Niederlassung lag erhöht
am Rande eines Waldes, während im Tale der Otterbach das nötige Wasser lieferte. Neben der Klause erhob sich eine
Kapelle, in der die Mönche während der Woche ihren Gottesdienst verrichteten. Am Samstag wanderten sie nach
Münster zur Kirche ihres Abtes.
Unsere Vorfahren, der Stamm der Baiern, kam aus dem Osten, wo sie auf dem nördlichen und südlichen Ufer der Donau
zwischen Wien und Budapest am Ende des 5. Jhd. wohnten. In dieser Gegend lernten sie die Irrlehre des Arius
kennen. Sie war hauptsächlich auf dem Balkan vertreten. Die einheimische Bevölkerung suchte die Lehre gerade bei
den anwohnenden Germanen zu verbreiten. So kam es, dass die Goten und Langobarden die Lehre des Arius, den
Arianismus, annahmen und Jahrhunderte lang bewahrten. Auch die Baiern wurden gewonnen. Sie brachten den arianischen
Glauben mit in ihre neue Heimat an der Donau und an der Isar. Arius lehrte, dass Christus nicht gleichen Wesens
mit dem Vater, sondern ihm nur ähnlich sei. Das Konzil von Nizäa hatte die Lehre als Irrlehre verworfen, aber sie
behauptete sich noch lange in den Ländern an der Donau. Der Schluss ist naheliegend, dass die irischen Mönche
allen Fleiß daran setzten, unseren Vorfahren eine richtige Auffassung von dem Geheimnis der Heiligsten
Dreifaltigkeit beizubringen. Es ist richtig, dass das Dreifaltigkeitsfest erst am Ende des 5. Jhd. allgemein
eingeführt wurde. Es war die Zeit, in der in Spanien, in dem die arianischen Westgoten eine Heimat gefunden,
neue trinitarische Streitigkeiten ausbrachen. Aber was hindert uns anzunehmen, dass das Geheimnis von der
Heiligsten Dreifaltigkeit schon früher verehrt und gepredigt wurde? Es ist ferner auch richtig, dass in späteren
Jahrhunderten, in der Zeit der furchtbaren Seuchen des 14. Jhd. oder im 17. Jhd. nach dem schrecklichen
Dreißigjährigen Krieg mit seinen großen Verwüstungen und Krankheiten ein Anschwellen der Verehrung der heiligsten
Trinität festzustellen ist. In diesen späteren Jahrhunderten entstanden vielfach Wallfahrtsorte und Bruderschaften
zu Ehren der Heiligsten Dreieinigkeit. Eine solche Bruderschaft wurde an der Kirche im nahen Oberhatzkofen
errichtet. Wenn aber heute noch in Otterbach das Dreifaltigkeitsfest gefeiert wird, so sehe ich darin ein altes
Erbstück aus der frühesten Zeit.
Wir müssen daher annehmen, dass in Otterbach bereits eine Kapelle bestand, als 870 Bischof Ambricho von Alawichus
das Waldgebiet eintauschte. In ihr wurde schon damals das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit in besonderer
Weise verehrt. Auf diese Weise verblieb die Kapelle bei Münster, kam also nicht an Hatzkofen obwohl die
Nachbarspfarrei bei Seidersbuch nahe an Otterbach heranreichte. Auch die zweite Frage findet so ihre Erklärung.
Der Kirche wurden zu ihrem Unterhalt ursprünglich die Felder in der Galgenlohe überlassen. Später fielen sie an
die Kaplanei auf der Burg zu Rottenburg. Als gegen 1500 der Pfarrer in Gisseltshausen die Kaplanei übernahm und
auch in den Markt übersiedelte, wurden sie nun dem Pfarrvitum überlassen.

Sankt Leonhard
Als der Nachwuchs aus dem Westen ausblieb, starben die irischen Mönche nach einem Jahrhundert in ihren
Niederlassungen aus. Ihre Siedlungen fielen an den Herzog oder an den zuständigen Bischof. In Regensburg wirkte
am Anfang des 8.Jhd. der Heilige Erhard, dessen Namen uns das Salzburger Verbrüderungsbuch überliefert. Sein Grab
fand er in der Stadt Regensburg, wo es im Osten von der Niedermünsterkirche lag. (Erhardigruft, Erhardibrunnen). Von
ihm hatte auch das frühere Erhardihaus seinen Namen. Es wurde durch Bomben zerstört, erstand als Kolpingheim neu
aus den Ruinen. Erhard wurde erst 1051 offiziell durch Papst Leo IX., der seine Reliquien erhob, in die Zahl der
Heiligen aufgenommen. Wir dürfen auch im vorliegenden Falle vermuten, dass seine Verehrung viel weiter zurückgreift.
So wird die Feier seines Todestages in Oberotterbach ein altes Erbstück sein. Der Heilige Bischof bereiste von
Regensburg aus das flache Land. Vielleicht weilte er auch im damaligen Kirchlein zu Oberotterbach, nahm dort
kirchliche Handlungen vor und erwies ihm seine Gunst.
Mit dem Namen der Persönlichkeit des Bischofs Erhard bewegen wir uns in einer Zeit, die 1200 bis 1250 Jahre
zurückliegt. Patron der Kirche in Otterbach ist heute der heilige Leonhard. Seine Verehrung kam in unseren Landen
erst viel später auf, nämlich im 12. Jhd. Damals bauten französische Ritter in Regensburg eine Kirche zu Ehren
des Heiligen Leonhard. In diese Zeit fällt auch der Bau einer Kirche in Oberotterbach. Von diesem Bau haben sich
nur die Untergeschosse des Turms erhalten. Nach 1200 stiftete Graf Konrad I. von Rottenburg-Moosburg, der ein
besonderer Verehrer des heiligen Leonhard war, an der Kirche in Otterbach ein Benefizium und wies ihm die Einkünfte
aus einer Reihe von Höfen der Umgebung zu, Breiten, Reckerszell usw. Die Dotierung bestand noch 1600, das
Benefizium war aber nicht mehr besetzt. Großen Aufschwung nahm die Verehrung, des Heiligen Leonhard im 15. Jhd. Er
wurde allmählich zum Patron für die Hausgenossen des Menschen, für das Vieh, besonders das Pferd. Der Heilige
Leonhard war in der Hallertau hoch angesehen, wo der Schimmel in Sage und Geschichte eine große Rolle spielt. In
die Zeit des 15. Jhd. fällt wieder ein Neubau der Kirche in Otterbach. Diesem Bau gehören die Obergeschoße des
Turmes an. Einem dritten Höhepunkt der Verehrung des heiligen Leonhard stellen wir im 18. Jhd. fest. In dieser
Zeit wurde die heutige Kirche gebaut. Pfarrer in Rottenburg war damals Franz Xaver Hörl, ein gelehrter Mann,
Doktor der Theologie und beider Rechte, später Kanonikus bei St. Martin in Landshut. Die Pläne für den Neubau
fertigte der Landshuter Hofmaurermeister Johann Georg Hirschstötter. Die Maurerarbeiten führte Meister Josef
Dielinger von Rottenburg aus. Die Kirche stellte künstlerisch eine beachtliche Leistung dar. Die Zimmererarbeiten
hatte Parlier Anton Gaisreiter von Niedereulenbach übernommen. 1755, also vor 200 Jahren, war der Bau fertig. In
diesem Jahr wurde ihr Inneres eingerüstet und der Maler Ignaz Kaufmann aus Landshut bestieg die Bretter, um an der
Decke des Presbyteriums und des Langhauses seine großartigen Bilder von der Taufe und der Aufnahme des heiligen
Leonhard in den Himmel zu entwerfen. In einem Chronogramm hält er das Jahr 1755 fest. Das Bild auf dem Hochaltar
malte Peter Horemans in München. Es wäre noch eine Reihe von Handwerkern zu nennen., die sich an der
Ausschmückung der Kirche beteiligten, der Bildhauer Johann Paul Wagner von Vilsbiburg, der Maler Johann Anton
Schweinhuber in Rottenburg, der Faßmaler Georg Andre Zellner von Furth, der Schreiner Amantius Fehlweck in
Rottenburg.
Seine Kommunionbank ist eine bedeutende Leistung. Die Wallfahrt hielt bis 1830 an. In diesem Jahr wurde eine
große Feier veranstaltet. Vorausgegangen war eine schwere Seuche, die das Vieh in den Ställen dezimierte. Sie
hörte auf, als sich die Bauern zum heiligen Leonhard in Oberotterbach verlobten. Am Jakobustag des Jahres 1830
wallten viele Züge von Bauern aus den umliegenden Pfarreien zur Kirche. Sie brachten ihrem Patron ein Wachsopfer,
das die Gestalt eines Kalbes hatte. Der Landrichter in Rottenburg spottete über den modernen Tanz um das wächserne
Kalb und verurteilte die Geistlichen zu einer Geldstrafe wegen Vergehens gegen die staatliche Feiertagsordnung.
Nach dem Feste wurde es um Otterbach stiller. In meiner Jugend kam, soviel ich mich erinnere, nur noch eine
Gemeinde: ich meine, es was Niedereulenbach. In der Nähe dieses Dorfes liegt Waselsdorf, dessen Bauern einst
zum Unterhalt des Kaplans von Oberotterbach einen Beitrag leisten mussten. Aber immer noch wurden und werden die
drei Feste, Dreifaltigkeit, St. Erhard und St. Leonhard in Otterbach begangen. Sie waren das Leitmotiv für unsere
Arbeit, harte Rodungsarbeit, die in unbekanntes, unerforschtes Neuland vorstieß.

Die Wallfahrtskirche St. Leonhard ist eine wahre Fundgrube für passionierte Heimatkundler. Schon im 12.
Jahrhundert bestand in Oberotterbach eine Kaplanei, und die Leonhardifahrten dorthin waren damals weitum
bekannt.
Der Festzug zu der 750 Jahrfeier




Anzeige aus dem Jahre 1931
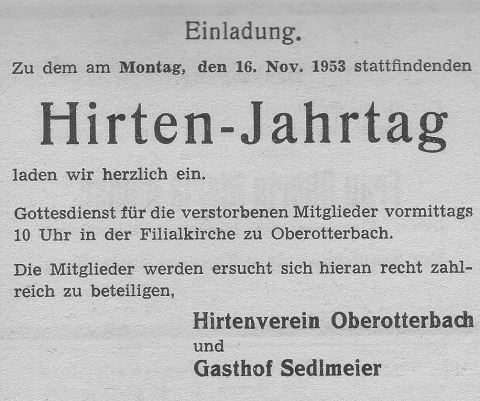
Anzeige aus dem Jahre 1953
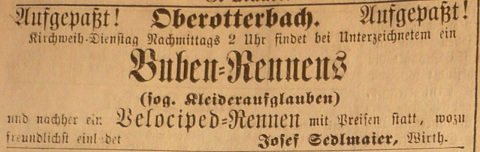
Anzeige aus dem Jahre 1885
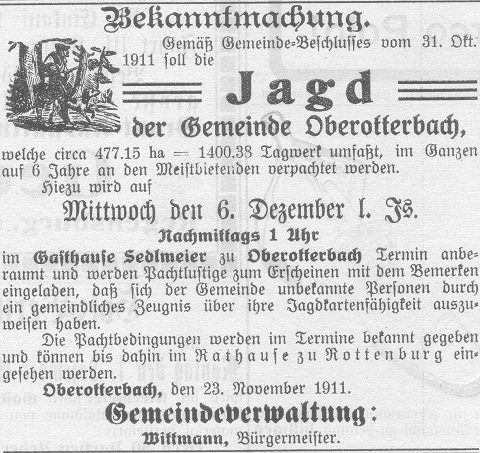
Anzeige aus dem Jahre 1911
Die Kuhprozession in Oberotterbach am Jakobstage, 25. Juli 1829.

Du wirst vielleicht, lieber Leser, Deinen Kopf schütteln, wenn Du diesen Titel liest. Es geht Dir,
wie es mir gegangen hat, als ich auf diesen Titel zum erstenmal im Repertorium des Landshuter
Staatsarchivs stieß. Meine Spannung hatte den Höhepunkt erreicht, als mir das betreffende Aktenbündel
in die Hand gelegt wurde. Daher will auch ich, lieber Leser, Deine Geduld nicht länger auf die Probe
stellen, sondern auf Grund des amtlichen Materials erzählen, was es mit dieser Kuhprozession in
Oberotterbach am 25. Juli 1829 für eine Bewandtnis habe.
Die Sache beginnt mit einer großen Viehseuche, die im Jahre 1829 die Ställe der Bauern des
Rottenburger, Hohenthanner und Schmatzhauser Bezirkes heimsuchte und ausräumte. Als die Seuche
erloschen war, verlobten sich die Bauern nach Otterbach. Sie brachten 45 fl. zusammen, womit sie eine
große Kuh aus rotem Wachs beim Lebzelter bestellten. Nach den damaligen Preisen war sie einen ganzen
oder wenigstens einen halben Zentner schwer. Das war das Geschenk, das die Bauern ihrem Patron, dem
hl. Leonhard, in feierlicher Prozession überreichen wollten. In Rottenburg wurde am Skapulierfeste
vom Pfarrer auf der Kanzel der Bittgang und die Gottesdienste verkündet. Es war der 25. Juli, das
Fest des hl. Apostels Jakobus, also ein abgeschaffter Feiertag, in Aussicht genommen worden. Als der
Morgen des Festtages anbrach, strömten die Bauern in hellen Scharen zum Heiligtume des hl. Leonhard
in Oberotterbach. Von Rottenburg aus führte sie Kooperator Hanneseder prozessionsweise zur
Gnadenstätte, während der Kooperator von Hohenthann die Wallfahrer aus dieser Gegend begleitete. Er
hielt nachher auch ein Amt. Den Mittelpunkt der großartigen Prozession bildete die rote Kuh, die von
vier Jungfrauen auf einem Gestelle getragen wurde. Nebenher gingen weißgekleidete Mädchen, die
brennende Kerzen in Händen trugen. Helle Freude erfüllte die Teilnehmer. Pfarrer Zech hielt das
Hochamt. Die Bauern spendeten viel Geld in die Opferteller.
Soweit war die Sache zu aller Zufriedenheit verlaufen. Sie hatte aber ein übles Nachspiel. Die Bauern
hatten zwar das Landgericht Pfaffenberg, zu dem damals der Rottenburger Bezirk gehörte, um Erlaubnis
gebeten der den Landrichter vertretende Assessor Forster hatte nicht ja und nicht nein gesagt. Er
machte die Bittsteller nur auf die Folgen aufmerksam, die die Sache nach sich ziehen könnte, wenn sie
angezeigt würde. Die Bauern schlossen aus diesen Worten, dass die hohe Obrigkeit ihre Augen zudrücke,
wenn sie den Bittgang abhalten würden. Das Unheil schreitet schnell. Ein eifriger Gerichtsdiener
hatte nichts Eiligeres zu tun, als bei seiner vorgesetzten Behörde Anzeige zu erstatten. Er hatte
auch einen Augenzeugen gefunden, der ihm zu Diensten war. Seine Gnaden, der Landrichter von
Pfaffenberg, brach in hellen Zorn aus, als er die Anzeige erhielt. Er konstruierte zwei schwere
Staatsvergehen. Das eine bestand darin, dass an einem abgeschafften Festtage ein feierlicher
Gottesdienst stattgefunden hatte, das andere erblickte Se. Gnaden darin, dass ohne Erlaubnis des K.
Landgerichtes ein Bittgang abgehalten worden war. Erschwerend empfand er es, dass die Geistlichkeit,
darunter zwei Pfarrer, wovon einer sogar Dechant, sich daran beteiligt. Sie hätten doch die Pflicht,
ihren Schäflein das Beispiel treuer Befolgung der Staatsgesetze zu geben. Besonderen Zorn hatte der
Landrichter auf den Pfarrer von Rottenburg, dem er Habsucht und Unbildung vorwarf. Seine Entrüstung
erreicht in den Worten seines Berichtes an die Regierung des Regenkreises ihren Höhepunkt: „Wie soll
das Allerheiligste durch goldene Kälber verdrängt oder durch blutige Tieropfer beleidigt werden?“ Die
Auslagen für das Wachs hätte „nach dem Willen des göttlichen Stifters der heiligen Religion zum Beten
der Schulen und Armen“ verwendet werden sollen. Die Regierung ordnete eine Vernehmung der
Gemeindevorsteher und Pfarrer an. Als sie abgeschlossen war und die Regierung die Akten in Händen
hatte, kam von dort eine scharfe Aufforderung an den Assessor Forster, dass er sich wegen seiner
Antwort an die erlaubnisheischenden Bauern binnen 72 Stunden verantworte. Auch der Kooperator von
Rottenburg musste binnen 48 Stunden eine Erklärung abgeben, ob er im Auftrag seines Vorgesetzten die
Prozession geführt habe. Eine gleiche Frist wurde Pfarrer Zech gestellt, der sich erklären musste, ob
er die Gottesdienste auf der Kanzel verkündet habe. Nachdem die Antworten in Regensburg, dem Sitze
der Regierung des Regenkreises, eingelaufen waren, fällte diese das Urteil. Bei Assessor Forster und
den Gemeindevorstehern wurde von einer Geldstrafe abgesehen; sie bekamen aber eine ernstliche Rüge.
Dechant Gebhard von Hohenthann wurde zu 15 fl. und Pfarrer Zech von Rottenburg sogar zu 25 fl.
verurteilt. Das Ordinariat bestätigte die Sentenz der Regierung. In besonders scharfen Worten war der
Verweis an Pfarrer Zech gehalten. Er hatte bei der Vernehmung versucht, sich durch verschiedene
Winkelzüge aus der Schlinge zu ziehen. Das Ordinariat erteilte ihm ferner den Auftrag, die Kuh aus
der Kirche zu entfernen. Aber auch die Kooperatoren erhielten eine ernstliche Verwarnung; sie hätten
wissen sollen, dass man staatlichen und kirchlichen Gesetzen mehr gehorchen müsse als einem Auftrag
des unmittelbaren Vorgesetzten. Dechant Gebhard und Pfarrer Zech zahlten die Buße. Die Quittungen
liegen bei den Akten. Das Geld wurde, dem sozialen Empfinden des Landrichters entsprechend, zur
Anschaffung von Büchern und Schuhen an arme Schulkinder verwendet, der Rest an Bedürftige
verteilt.
Das ist die Geschichte von der roten Kuh in Oberotterbach, so sich am Jakobustag, dem 25. Juli 1829
ereignet hat. Sie ist wert, dem Staube der Archive entrissen zu werden. Denn es fallen durch sie
grelle Lichter auf die Lage der Kirche in Bayern vor hundert Jahren. Gewiss wäre es nach unserem
Empfinden geziemender gewesen, wenn statt der Kuh eine große Kerze geopfert worden wäre. Wer kann
aber die Kirche hindern, wenn sie Gottesdienste und Bittgänge anordnet? Der Staat tat es damals auch
nur aus der Besorgnis heraus, dass durch das viele Beten seine Untertanen vom Erwerb und Verdienst
abgehalten, der Volksreichtum und die Steuerkraft dadurch gemindert würde.
P.W.F
|